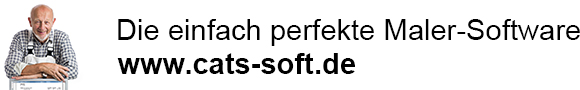Zum diesjährigen Ausbildungsbeginn fehlen dem deutschen Handwerk mal wieder die entsprechenden Lehrlinge. Tausende von Lehrstellen bleiben unbesetzt. Bis zum 31. Juli 2014 wurden bei den deutschen Handwerkskammern für das neue Ausbildungsjahr 85.000 Ausbildungsverträge eingetragen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren allein 28.000 Ausbildungsplätze noch unbesetzt. Handwerksbetriebe in Deutschland suchen verzweifelt nach Bewerbern für die Ausbildungsplätze – und es wird auch zunehmend schwierig, geeignete Kandidaten zu finden.
Zum diesjährigen Ausbildungsbeginn fehlen dem deutschen Handwerk mal wieder die entsprechenden Lehrlinge. Tausende von Lehrstellen bleiben unbesetzt. Bis zum 31. Juli 2014 wurden bei den deutschen Handwerkskammern für das neue Ausbildungsjahr 85.000 Ausbildungsverträge eingetragen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren allein 28.000 Ausbildungsplätze noch unbesetzt. Handwerksbetriebe in Deutschland suchen verzweifelt nach Bewerbern für die Ausbildungsplätze – und es wird auch zunehmend schwierig, geeignete Kandidaten zu finden.
Anstatt darüber zu jammern und zu klagen, hat die Handwerkskammer Unterfranken vor zwei Jahren das Projekt „Karriereprogramm Handwerk“ ins Leben gerufen. Es soll jungen, leistungsstarken und motivierten Menschen, die ihr Studium vorzeitig ohne Abschluß beenden, eine Perspektive für den Berufsstart im Handwerk geben und sie bis zur Meisterausbildung führen. Ein wirklich spannendes und innovatives Programm, das bereits Früchte trägt.
Malerblog.net sprach mit Christina Huck, Karriereberaterin der Handwerkskammer in Unterfranken, die dabei hilft, die Fast-Akademiker im Schnellverfahren zu Führungskräften auszubilden.
Wie würden Sie das „Karriereprogramm Handwerk“ beschreiben?
Das „Karriereprogramm Handwerk“ richtet sich vorrangig an Studienabbrecher. Wer sein Studium vorzeitig beendet, erhält durch das Karriereprogramm eine konkrete berufliche Perspektive. Die Teilnehmer des Karriereprogramms können im Idealfall in nur drei Jahren ihren Meister machen und dann die Karriereleiter erklimmen. Ziel unseres Programmes ist es, leistungsstarke und motivierte junge Menschen und Handwerksbetriebe paßgenau zusammenzubringen. Und wir wollen natürlich auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem wir leistungsstarken jungen Menschen eine Premiumausbildung im Handwerk anbieten.
Seit wann gibt es das Programm?
Der Startschuß für das Pilotprojekt fiel im Mai 2012, damals mit den beiden Ausbildungsberufen „Tischler/in (Schreiner/in)“ und „Hörgeräteakustiker/in“. 2013 kamen weitere Berufe hinzu und aktuell führen wir das Karriereprogramm in die Verstetigungsphase über. Das heißt, wir öffnen es und vermitteln in allen Ausbildungsberufen, für die auf Seiten unserer Handwerksbetriebe Nachfrage nach hoch qualifizierten Auszubildenden besteht.
Können auch Malerbetriebe das Karriereprogramm in Anspruch nehmen?
Selbstverständlich sind Malerbetriebe herzlich willkommen. Gerade wenn es sich um Betriebe handelt, die besondere Anforderungen haben und eine handfeste Perspektive bieten können.
Wer sind die Initiatoren?
Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Handwerkskammer für Unterfranken und der Universität Würzburg in Kooperation mit der Handwerkskammer-Service GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Handwerkskammer für Unterfranken. Mittlerweile kooperieren wir auch eng mit den beiden Hochschulen für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und Aschaffenburg. Zu den Partnern gehören außerdem die Bundesagentur für Arbeit Würzburg, die Beruflichen Schulen Unterfrankens sowie natürlich zahlreiche unterfränkische Betriebe.
Wer kann sich bewerben?
Primär richtet sich das Angebot an Studienaussteiger, die sich im Handwerk neu orientieren möchten. Willkommen sind jedoch auch Hochschulabsolventen und Abiturienten. Wichtig ist, daß die potentiellen Teilnehmer des Karriereprogramms Leistungsbereitschaft und eine hohe Motivation mitbringen, denn sie lernen sehr viel in verkürzter Zeit. Belohnt werden sie mit einer fundierten beruflichen Ausbildung, sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten und entsprechend interessanten Berufsperspektiven.
Wie ist die Resonanz, nehmen mehr Männer oder Frauen daran teil?
Das Programm bietet sowohl für junge Männer als auch für junge Frauen gute Perspektiven. Derzeit entscheiden sich noch mehr männliche Bewerber dafür, den Weg im Handwerk beschreiten. Ich kann aber nur an alle Frauen appellieren, sich über das Karriereprogramm und Handwerksberufe im Allgemeinen zu informieren. Denn auch für sie gibt es hier sehr gute Möglichkeiten.
Wie wird das Programm angenommen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Die Resonanz auf das Programm ist sehr positiv. Die meisten unserer Teilnehmer schätzen die praktische Arbeit und den Fakt, daß sie am Ende des Tages sehen, was sie erschaffen haben. Die Betriebe freuen sich über die persönliche Reife und sehr gute Vorbildung der Auszubildenden. Zum Teil investieren sie schon frühzeitig in spezielle Lehrgänge für diese Auszubildenden und übertragen ihnen Verantwortung. Der Erfolg des Programms zeigt sich auch darin, daß im Pilotprojekt kein ehemaliger Studienabbrecher seine Handwerksausbildung abgebrochen hat, weil sie nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat.
Wie läuft die Ausbildung genau ab? Und wie lange dauert sie? Endet sie immer mit der Meisterausbildung?
In der Regel findet zunächst ein individuelles Beratungsgespräch statt. Ziel ist es herauszufinden, wo die Interessen und Stärken des potentiellen Auszubildenden liegen bzw. welche speziellen Wünsche und Bedürfnisse bei einer Ausbildung berücksichtigt werden sollen. Sobald klar ist, welches Gewerk in Frage kommt, wird ein geeigneter Betrieb für ein Probearbeiten / Praktikum vermittelt. Im Idealfall schließt sich eine Ausbildung an. Aufgrund der Vorbildung besteht die Möglichkeit, die Ausbildungsdauer im Voraus um 12 Monate zu verkürzen. Diese Verkürzung ist jedoch nicht zwingend. Zum Ende der Ausbildung kann bereits mit der Weiterbildung zum Technischen Fachwirt (HWK) begonnen werden, dieser beinhaltet die Teile III und IV der Meisterausbildung. Die Prüfung findet im Anschluß an die Gesellenprüfung statt. Grundsätzlich kann danach direkt mit den Teilen I und II der Meisterausbildung gestartet werden. Es besteht jedoch auch die Option, erst noch mehr praktische Erfahrungen zu sammeln. Alternativ kann auch der Weg zum Geprüften Betriebswirt (HWO), Betriebsinformatiker (HWO) oder der Spezialisierung beispielsweise als Restaurator im Handwerk beschritten werden.
Welche Firmen dürfen daran teilnehmen bzw. nach welchen Kriterien werden die teilnehmenden Betriebe ausgewählt?
Es geht um die Ausbildung leistungsstarker Auszubildenden. Daher sollten die Betriebe neben dem Bedarf auch die Möglichkeit haben, auf die Bedürfnisse dieser Auszubildenden einzugehen und die Ausbildung entsprechend anpassen. Interessant sind natürlich Betriebe, die im Anschluß an die Ausbildung einen Bedarf auf der Fach- und Führungsebene haben oder einen Betriebsnachfolger suchen.
Was kommt auf die „Neulehrlinge“ zu?
Die Teilnehmer des Karriereprogramms erwartet eine Ausbildung im dualen System, das bedeutet eine Mischung aus praktischer Ausbildung im Betrieb, schulischen Phasen an der Berufsschule und überbetrieblichen Lehrgängen im Bildungszentrum. Wer seine Ausbildung verkürzt, muß die übersprungenen Lehrinhalte selbständig aufarbeiten. Das erfordert viel Einsatz und setzt auch eine hohe Eigenmotivation voraus. Das gilt auch für die Fortbildungsphase. Die Weiterbildung zum Technischen Fachwirt (HWK) nämlich wird neben der Ausbildung gemacht, also abends und an Samstagen.
Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, daß so viele Lehrstellen unbesetzt bleiben?
Hintergrund ist unter anderem der demografische Wandel. Es gibt weniger Schulabgänger, die sich potentiell um eine Lehrstelle bewerben könnten. Hinzu kommt der noch immer anhaltende Trend zu weiterführenden Schulen. Hinzu kommt, daß natürlich andere Wirtschaftsbereiche mit dem Handwerk um die weniger gewordenen Auszubildenden konkurrieren.
Was denken Sie, warum Handwerksberufe in den Augen junger Leute zunehmend unattraktiver geworden sind? Warum wollen viele studieren?
Diese Einschätzung kann ich nicht teilen, denn es zeigt sich, daß das Handwerk vor allem von jungen Leuten mittlerweile sehr positiv wahrgenommen wird. Dazu tragen sicherlich die intensiven Bemühungen des Handwerks, sei es von Organisationen wie Handwerkskammern, Berufsverbänden oder Innungen, sowie einzelner Betriebe bei, die verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben und zeigen, wie innovativ, kreativ und zukunftsorientiert das Handwerk ist. Die bundesweite Imagekampagne des Handwerks hat auf diesem Gebiet ebenfalls gute Erfolge erzielt, wie Umfragen zeigen. Auch in der Politik hat ein Umdenken eingesetzt. Dort hat man erkannt, daß unsere Wirtschaft nicht nur Akademiker braucht. Beide Bildungswege stehen gleichberechtigt nebeneinander. Das ist eine wichtige Botschaft, denn sie sichert die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, die sowohl beruflich ausgebildete Fachkräfte als auch Akademiker braucht.