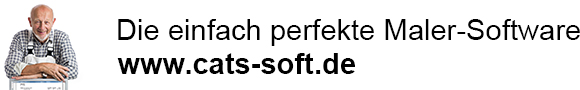Seit 15. Juni 2020 kann sie in den Stores von Apple und Google kostenfrei heruntergeladen werden. Die Rede ist von der deutschen „Corona-Warn-App“. Im Auftrag der Bundesregierung wurde sie von Deutscher Telekom und SAP in nur 50 Tagen entwickelt. Wie das Magazin Spiegel berichtet, werden sich bis Ende 2021 die Gesamtkosten für Entwicklung, Betrieb, Test und Werbung auf rund 68 Millionen Euro belaufen.
Andere europäische Länder haben ebenfalls auf eigene, nationale Corona-Apps gesetzt, mit mehr oder weniger Erfolg. Norwegen musste seine Tracing-App aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken Anfang Juni stoppen. Die Corona-Apps in Italien und Frankreich scheinen wegen geringer Nutzungsrate zu floppen. In Deutschland zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom jedoch, dass jeder zweite Smartphone-Nutzer über 16 Jahren die Corona-Warn-App dauerhaft nutzen will. Das entspräche 28 Millionen Menschen.
Ziel der Corona-Warn-App ist es, Infektionsketten schneller zu erkennen und zu unterbrechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte dazu in ihrem Podcast: „Wer kann sich schon an alle Begegnungen der letzten 14 Tagen erinnern? Wer kennt schon jeden, neben dem er vielleicht in der U-Bahn saß?“ Genau diese Problemstellung hat die Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter in der ersten Pandemiephase wesentlich erschwert. Die App könnte hier zu einer sinnvollen Ergänzung werden.
Die Idee der App ist, dass Personen, die die App nutzen und positiv getestet werden, freiwillig andere App-Nutzer darüber informieren, so dass diese gewarnt sind. Was die Gewarnten mit diesem Wissen machen, bleibt ihnen überlassen. Alles erfolgt auf freiwilliger Basis und absolut anonymisiert. Zu keinem Zeitpunkt erlaubt das Verfahren Rückschlüsse auf die Nutzer oder deren Standort. Eine Schlüsselrolle kommt der Bluetooth-Technologie zu, die dazu genutzt wird, Abstand und Begegnungsdauer zwischen den Personen zu messen, die die App installiert haben. Die Smartphones tauschen dabei untereinander Zufallscodes (verschlüsselte Bluetooth-IDs) aus und „merken“ sich diese für eine befristete Zeit. Gibt ein infizierter Nutzer seine positive Testung der App bekannt, werden seine Zufallscodes der App zur Verfügung gestellt. Die Warn-App prüft nunmehr auf dem jeweiligen Smartphone der anderen Nutzer, ob ein Kontakt bestand und zeigt bei positiver Prüfung eine Warnung an.
Nutzen kann die kostenfreie App jeder, der über ein Android-Smartphone ab Android 6 oder ein iOS-Smartphone ab dem iPhone 6s unter iOS 13.5 verfügt.
Einer der frühen Nutzer der Corona-Warn-App ist Carsten Andrä, geschäftsführender Gesellschafter der C.A.T.S.-Soft GmbH. Die mittelhessische Softwareschmiede entwickelt selbst mobile Applikationen, kurz Apps genannt. Andrä ist mit dem Thema also bestens vertraut. Welchen Blick hat er auf die Corona-Warn-App als Softwareentwickler und welche Erfahrungen hat er als Anwender bislang gemacht? Diese und mehr Fragen hat er Malerblog.net beantwortet.

Herr Andrä, Sie haben bereits kurz nach Veröffentlichung der Corona-Warn-App diese auf Ihr Smartphone geladen. Warum?
Nun ja, ich denke, da war das technische Interesse schon ein wichtiger Faktor. Gerade in IT-affinen Kreisen wurde ja viel im Vorfeld über die App diskutiert und da ist es schon interessant, was sich dann hinter dem Ergebnis verbirgt. Angesichts der kommunizierten Kosten von fast 70 Millionen Euro waren die Erwartungen doch hoch.
Natürlich spielt auch der Aspekt, die Pandemie gemeinsam versuchen einzudämmen, eine Rolle, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Erwartungen hier vielleicht doch zu hoch angesetzt sind und ob das Ziel der schnellen und einfachen Unterbrechung von Infektionsketten letztendlich erfüllt werden kann.
Seit einem Monat ist die App jetzt verfügbar. Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der Corona-Warn-App gemacht?
Die Installation bzw. der Download aus dem Apple Store bzw. Google Play klappt auf neueren Geräten in der Regel problemlos. Die App wird durch die normalen App-Updates der Stores auf dem Laufenden gehalten. Derzeit beschränken sich diese aber auf Fehlerkorrekturen und Optimierungen.
Die Bedienung der App ist im normalen Ablauf sehr einfach. Es gibt nur wenige Funktionen und ein paar Textinformationen und Hinweise.
Ob sich das so auch bei der Mitteilung eines möglichen positiven Corona Testergebnisses so verhält, kann ich aus eigener Erfahrung glücklicherweise nicht berichten. Sicherlich kann das komplizierter werden, wenn das entsprechende Labor nicht digital angeschlossen ist und der Anwender sich dann durch die Telefonhotline quälen muss, um eine Freischaltung per TAN zu bekommen. Das könnte viele Anwender abschrecken.
Immer wieder heiß diskutiert wurde bei der Warn-App das Thema „Datenschutz“ und „Privatsphäre“. Sie müssen sich bei Ihren Eigenentwicklungen ebenfalls mit dieser Frage auseinandersetzen. Welche Einschätzung haben Sie in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit?
Datenschutz und Privatsphäre spielen eine zentrale Rolle. Ich denke, das ist mit dem in Deutschland gewählten Ansatz auch ganz gut gelungen. So wurden bereits im Vorfeld viele öffentliche Gruppen (Datenschutzbeauftragte, CCC usw.) einbezogen und durch den transparenten Ansatz bis hin zu dezentraler Speicherung und Open-Source wurde sicher viel Vertrauen geschaffen.
Auch wichtig war es, auf die direkte Ortung von Handys zum Beispiel durch GPS-Daten zu verzichten. Dieser Weg, der in einigen Ländern verfolgt wird, wäre datenschutzrechtlich eine Katastrophe gewesen, ebenso wie eine zunächst angedachte zentrale Speicherung der Daten.
Kritisch bleibt, dass die Umsetzung der grundlegenden Bluetooth-Abstandsmessung nicht öffentlich ist, sondern dass diese von Google bzw. Apple nur in Form einer nicht offenen API zur Verfügung gestellt wird. Allerdings ist das für einen Anwender, der eh bereits Google Android oder Apple iOS als Betriebssystem nutzt aus Datenschutzsicht wohl eher das kleinere Problem. :-)
Die Corona-Warn-App soll von möglichst vielen Menschen genutzt werden, damit sie ihren Nutzen voll ausspielen kann. Konnte dieses Ziel aus technischer Sicht Ihrer Meinung nach umgesetzt werden?
Wie bereits oben erwähnt klappt die Installation auf modernen Smartphones, insbesondere solchen der Oberklasse problemlos. Bei älteren Smartphones, auch solchen, die noch die Systemvoraussetzungen erreichen, wird teilweise von Problemen berichtet.
Außerdem wird die Zahl der möglichen Anwender durch die Tatsache, dass Google die Umsetzung im internen Teil von Android umsetzt weiter eingeschränkt. So ist eine direkte Installation zum Beispiel auf Handys von Huawei derzeit nicht möglich, auch wenn daran gearbeitet wird.
Sicher wäre es wünschenswert, wenn mehr und vor allem auch ältere, günstigere Smartphones die App nutzen könnten. Ob diese Einschränkung das Ziel der App jedoch nachhaltig beeinflusst ist eher ungewiss. Schließlich nutzen viele Anwender heutzutage Smartphones im Rahmen eines Mobilfunkvertrages und da kommt oftmals alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kann man dies allerdings ebenfalls kritisieren.
Die App wurde im ersten Monat bereits über 15 Millionen Mal aus den App Stores von Google und Apple geladen. Corona-Apps in anderen europäischen Ländern drohen zu floppen. Sind die Deutschen doch so keine Digitalisierungs-Muffel wie so oft behauptet wird?
Grundsätzlich ist die Tatsache, dass bisher circa 15,5 Millionen Downloads erfolgten, sicher erst einmal bemerkenswert, aber die reine Downloadzahl ist sicher nicht aussagekräftig für den Erfolg. Bei vielen Anwendern war wohl die Neugier ein wesentlicher Aspekt für die Installation.
Aber sicher ist auch der in Deutschland gewählte Ansatz der offenen und transparenten Entwicklung mit ein Grund, dass Bürger ein gewisses Vertrauen mitbringen. Dies ist in Frankreich und Italien sicher anders gelaufen.
Es bleibt abzuwarten, wie viele Nutzer sich wirklich infizieren und das Testergebnis dann teilen und wie die Gewarnten dann wiederum reagieren. Das ist bei einem allgemeinen niedrigen Infektionsgeschehen sicher schwierig abzuschätzen. Es reicht also, wie in vielen anderen Bereichen der Digitalisierung nicht aus, einfach eine App zu installieren oder eine Software zu nutzen. Es muss auch Kompetenz und Verständnis für die Technologie geschaffen werden.
Die Deutschen pauschal als Digitalisierungs-Muffel zu bezeichnen ist aber sicher nicht richtig, wie andere Bereiche eindrucksvoll zeigen. Ich denke hierbei nur an unsere Kunden, die allesamt aus dem Handwerk kommen und in Sachen Handwerk 4.0 voll dabei sind.
Vielen Dank, Herr Andrä.