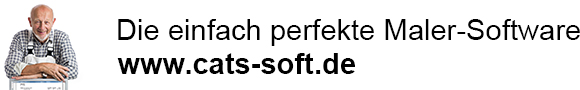Bürokratie steht heutzutage als Synonym für übertriebenen und zeitraubenden Papierkram und Formalismus. Handwerksbetriebe sind Kleinbetriebe. Sie haben nicht die Manpower, um all den Anforderungen, die mittlerweile an sie herangetragen werden, gerecht zu werden. Der Tag hat nur 24 Stunden und das Geld, um Mitarbeiter, Lieferanten, Abgaben, Steuern und Sozialversicherungen bezahlen zu können, wird auf der Baustelle verdient. In Zeiten voller Auftragsbücher machen sich die vielen bürokratischen Auflagen für die Handwerksbetriebe besonders schmerzlich bemerkbar, denn Zeit ist knapp und zusätzliche Belastung, die oft reiner Formalismus sind. Sie bringen in Kleinbetrieben den Betriebsinhaber oft an seine Belastungsgrenze.
Datenschutz-, Verbraucherschutz- und Arbeitsschutzvorschriften, Steuergesetze, Gewerbeabfallverordnung und GoBD, um nur ein paar Beispiele zu nennen, gelten für alle Unternehmen, egal welcher Größe. Es wird kein Unterschied gemacht, ob es sich um eine große Publikumsgesellschaft handelt oder um einen kleinen Handwerksbetrieb, der die Anforderungen zu erfüllen hat. Was in der Großindustrie auf viele Schulter verteilt und von Experten bearbeitet wird, muss in einem Handwerksunternehmen der Betriebsinhaber in der Regel allein meistern. Er muss daher nicht nur in seinem Beruf als Handwerker ein Fachexperte sein, sondern sich auch betriebswirtschaftlich stets auf der Höhe der Zeit befinden.
Von Politikern auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene ist immer wieder zu hören, dass sie sich für Bürokratieabbau einsetzen. Das jüngste Beispiel an Verordnung zeigt jedoch recht deutlich, woran es häufig hakt. Die EU-Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Unbestimmte Rechtsbegriffe und vage Formulierungen reihen sich in dem Paragraphenwerk fast nahtlos aneinander. Es fehlt an einem verständlichen Text mit klaren Handlungsanweisungen, sodass eine Umsetzung für jedermann problemlos möglich wäre. Handwerker sind keine IT-ler und auch keine Datenschützer. Während die Großindustrie ihre Rechts- und IT-Abteilung mit der Aufgabe betrauen, muss sich der Handwerksbetrieb selbst durchkämpfen oder von einem externen Dienstleister unterstützen lassen. Für die Betriebe entstehen Aufwand und Kosten, die sie zusätzlich belasten und die viele Betriebe nicht durch Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben können.
Vor allem Dokumentations- und Informationspflichten machen Handwerksbetrieben das Leben schwer. Während Betriebe arbeitsschutzrechtliche Dokumentationspflichten wie das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen oder die Erfassung von Arbeitszeiten zu ihrem Vorteil nutzen können, ist dies bei vielen anderen Dokumentations- und Informationspflichten nicht der Fall. Ein Beispiel dafür ist die Künstlersozialabgabe. Jeder Unternehmer hat jährlich seine Abgabepflicht zu prüfen und von sich aus der Künstlersozialkasse zu melden. Neben dem Erstellen der Dokumentation, die dem Betriebsprüfer der Rentenversicherung auf Verlangen vorzulegen ist, obliegt es sogar dem Betrieb festzustellen, ob die in Anspruch genommenen Leistungen überhaupt abgabepflichtig sind. Bei dem nicht gerade leicht verständlichen Regelwerk, mutiert eine vermeintlich leichte Dokumentations- und Abgabenpflicht für die meisten Unternehmer zu einer schwer zu durchblickenden Mammutaufgabe.
Eine weitere, zeitraubende Dokumentationspflicht kam im vergangenen Jahr mit der novellierten Gewerbeabfallverordnung hinzu. Um die korrekte Entsorgung von Abfällen wie Styropor zu überwachen und eine umweltverträgliche Entsorgung zu garantieren, ist nunmehr ein umfassendes Nachweisverfahren zu führen. Zwar wurde auf diesem Weg die zuvor problematische Entsorgung von Polystyrolabfällen wieder sichergestellt. Die Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen sowie die laufende Dokumentationspflege ist jedoch ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor für den Betrieb.
Unter dem Stichwort „Verbraucherschutz“ wurden in den letzten Jahren zudem neue Informationspflichten eingeführt, von deren Umsetzung auch Handwerksbetriebe betroffen sind. Die Informationspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz machte vielfach eine Ergänzung auf Webseiten und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich. Und das Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen beinhaltet nicht nur eine Informationspflicht, sondern erforderte teilweise ein organisatorisches Umdenken bei der Auftragsakquise in den Betrieben. Vermeintlich kleine Änderungen mit weitreichenden Folgen für die Betriebe.
Kein Gesetz, sondern eine Verwaltungsvorschrift der Finanzverwaltung beschäftigt seit geraumer Zeit ebenfalls die Betriebe. Die Rede ist von den „Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“, kurz GoBD genannt. Zwar richtet sich die GoBD als Verwaltungsanweisung an Finanzbeamte. Da sich diese aber im Rahmen einer Betriebsprüfung genau an diesen Grundsätzen orientieren, erlangt eine solche Verwaltungsvorschrift schnell Unternehmensrelevanz. Um Unannehmlichkeiten, Diskussionen oder gar juristische Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung zu vermeiden, sind die Betriebe bemüht, die GoBD-Anforderungen zu erfüllen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat im März 2018 Vorschläge für ein Bürokratieabbaugesetz III unterbreitet und dabei unter anderem auch die Komplexität der GoBD kritisiert. Er fordert eine Überarbeitung, eine Vereinfachung sowie eine bessere Verständlichkeit dieser Regelung. In seiner Begründung schildert der DIHK die Situation wie folgt: „Die Regelungen verursachen hohe Kosten und stehen in keinem Verhältnis zum eigentlichen Zweck, der Ermittlung der zu zahlenden Steuern. Aus der Praxis wird zudem berichtet, dass sich die Betriebsprüfungen im Wesentlichen auf die Einhaltung der formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung fokussieren, Mängel als gravieren eingeordnet werden und eine Schätzung mit erheblichen Steuernachzahlungen erfolgt. Hierdurch wird deutlich, dass Handlungsbedarf besteht, die GoBD zu überarbeiten und dabei zu vereinfachen. Ziel muss eine klarere und bessere Verständlichkeit der Regelungen sein, um Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen, Bürokratie abzubauen und die Digitalisierung zu fördern“
Obwohl seit Jahren in politischen Runden und auf Wahlkampfveranstaltungen Schlagworte wie „Bürokratieabbau“ und „Bürokratieentlastung“ in den Mund genommen werden, zeigt die Realität, dass bürokratische Anforderungen weiterhin Einzug in den Betrieben halten. Die vorgenannten Beispiele bilden nur einen kleinen Ausschnitt. Die Aufzählung ist keinesfalls abschließend. Sie lässt aber schon erkennen, dass die Summe aller Pflichten für einen Kleinbetrieb zeitlich erdrückend ist und falls externe Berater hinzugezogen werden zusätzlich sehr kostenintensiv werden kann. Betriebsinhaber im Handwerk werden um ihren Job nicht beneidet. Steigende Bürokratie bedeutet immer Zusatzarbeit ohne Bezahlung. Das macht die Betriebsführung im Handwerk nicht wirklich attraktiv. Nachfolgende Generationen reißen sich schon lange nicht mehr um eine Betriebsübernahme. Sie streben vielmehr Berufe an, in denen sie ihre persönliche Work-Life-Balance besser und schneller erreichen können.
Die Einführung von Dokumentations-, Nachweis- und Informationspflichten sowie von Auskunfts- oder Aufbewahrungspflichten erfolgt nie willkürlich. Es gibt immer gute Gründe für den Gesetzgeber, solche Maßnahmen den Betrieben aufzuerlegen. Mit etwas gutem Willen und politischer Kreativität sollten sich diese Ziele mit wesentlich weniger bürokratischem Zeit- und Kostenaufwand erreichen lassen.