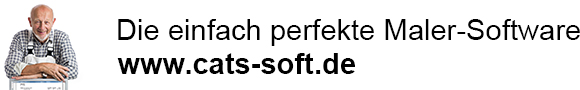Über das Wachstumschancengesetz wird seit Monaten gestritten. Von der Berliner Ampelkoalition und von Wirtschaftsverbänden wird es als Entlastungspaket für die Wirtschaft „gehypt“. Das Gesetz enthält beschleunigte Abschreibungsregeln, höhere Freibeträge, Freigrenzen und einiges mehr, was von der deutschen Wirtschaft dringend benötigt wird. Im Übrigen ist auch die Einführung der elektronischen Rechnung im B2B-Bereich dort verbrieft. Je länger jedoch zugewartet wird, umso unwahrscheinlicher dürfte auch hier der Einführungszeitpunkt zu halten sein. Es ist sicherlich kein Wumms-Gesetz, aber besser als gar nichts ist es für die Wirtschaft allemal. Die Bauwirtschaft beispielsweise verspricht sich durch die geplante Einführung besserer Abschreibungsmöglichkeiten für den Wohnungsbau einen wichtigen Konjunkturimpuls.
Nachdem der Bundesrat Ende November 2023 seine Zustimmung zu dem Gesetz versagt hatte, tagte gestern der Vermittlungsausschuss. Am Abend wurde ein Verhandlungsergebnis präsentiert. Zu diesem gehört unter anderem
- die Einführung einer degressiven Abschreibung auf Abnutzung (AfA) für Wohngebäude in Höhe von 5 Prozent,
- die Einführung einer degressiven AfA auf bewegliche Wirtschafsgüter für 9 Monate,
- eine auf vier Jahre befristete Anhebung des Verlustvortrags auf 70% (ohne Gewerbesteuer),
- die Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung.
Außerdem sind unter anderem Maßnahmen zur Vereinfachung des Steuersystems und zum Bürokratieabbau enthalten. Darüber hinaus schlägt der Vermittlungsausschuss vor, die im Wachstumschancengesetz vorgesehene Einführung einer Klimaschutz-Investitionsprämie und die Mitteilungspflichten innerstaatlicher Steuergestaltungen zu streichen
Eine echte Kompromisslösung ist dieses Verhandlungsergebnis allerdings nicht, da dieses nicht von der Union mitgetragen wurde. Die Union verweist darauf, dass man nicht einen Teil der Wirtschaft entlasten und einen Teil, speziell die Landwirtschaft, durch Streichung der Subventionen beim Agrardiesel, belasten könne. Dies ist für sie Grund genug, das Wachstumschancengesetz zu blockieren. Sie erwartet, dass sich die Ampelkoalition zugunsten der Landwirtschaft bewegt. Ob die Union und die Agrarwirtschaft da auch auf die Solidarität und das Verständnis in der Bauwirtschaft oder sonstigen Wirtschaftszweigen zählen können oder ob sich am Ende doch jeder selbst am nächsten ist, bleibt abzuwarten.
Über das Wachstumschancengesetz soll nunmehr am 22. März 2024 im Bundesrat erneut abgestimmt werden. Um dies erfolgreich über die Bühne zu bringen, sind die Stimmen der Union erforderlich. Bleibt also noch ein Monat Zeit, sich über die „offenen Baustellen“ zu verständigen. Bei der aktuellen Situation der Wirtschaft wäre ein echter Kompromiss für die ganze Wirtschaft und die Bevölkerung ein gutes Signal. Allerdings müsste sich dafür die Ampelkoalition bewegen.