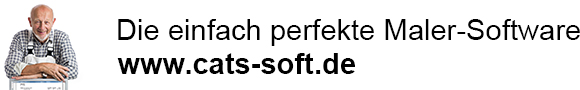Tattoos sind mittlerweile ein gern getragener Körperschmuck – auch in Deutschland. Eine Tätowierung ist nichts Ungewöhnliches mehr und Ausdruck der individuellen Persönlichkeit. Dass das Stechen des Tattoos aber mit Risiken verbunden ist und nicht immer alles glatt läuft, diese Erfahrung musste eine Pflegehilfskraft machen. Nachdem sie sich ein Tattoo auf ihren Unterarm hatte stechen lassen, entzündete sich die Haut an der tätowierten Stelle. Die Arbeitnehmerin wurde von ihrem Arzt für mehrere Tage krankgeschrieben, war also arbeitsunfähig.
Jetzt stellte sich die Frage der Lohnfortzahlung. Diese ist in §3 EFZG geregelt und entfällt, wenn den Arbeitnehmer ein Verschulden trifft.
§3 EFZG – Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen …
Die Arbeitgeberin lehnte die Lohnfortzahlung ab. So habe die Arbeitnehmerin bei der Tätowierung in eine Körperverletzung eingewilligt. Das Risiko einer sich anschließenden Infektion gehöre nicht zum normalen Krankheitsrisiko und könne dem Arbeitgeber nicht aufgebürdet werden, argumentierte die Arbeitgeberin. Die Arbeitnehmerin hingegen sah kein Verschulden auf ihrer Seite. Sie argumentierte, es habe sich ein sehr geringes Risiko, das nur in 1 bis 5 Prozent der Fälle auftrete, verwirklicht.
Das letzte Wort hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein. Die Richter gaben der Arbeitgeberin recht und bestätigten damit das Urteil der Vorinstanz. So entschied das LAG am 22. Mai 2025 (5 Sa 284a/24), dass sich die Arbeitnehmerin schuldhaft verhalten habe. Sie hätte bei einer Tätowierung damit rechnen müssen, dass sich der Unterarm entzünde. Dieses Verhalten stelle einen groben Verstoß gegen ihr eigenes Gesundheitsinteresse dar. Es sei keine fernliegende Komplikation, sondern komme – wie die Arbeitnehmerin ja selbst vorgetragen hatte – in bis zu 5 Prozent der Fälle vor. Zur Bewertung des Entzündungsrisikos zogen die Richter einen Vergleich zu Nebenwirkungen bei Medikamenten, die dann als „häufig“ angegeben würden, wenn diese in mehr als 1 Prozent aber weniger als 10 Prozent der Fälle aufträten. Zudem sei die Komplikation der Hautverletzung durch die Tätowierung selbst angelegt.
Quelle: Pressemitteilung Landesportal/Justiz Schleswig-Holstein vom 2.7.2025