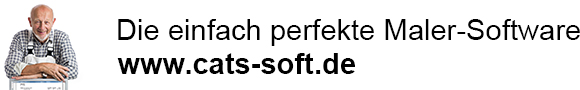Ein Badezimmer soll renoviert werden. Da brauchte es mehr als einen Handwerker. Installateur, Fliesenleger, Elektriker und Maler müssen Hand in Hand arbeiten, damit die Renovierung gelingt und vor allem die vom Auftraggeber gewünschten Termine eingehalten werden. Wenn sich die an der Baustelle beteiligten Betriebe jetzt nicht perfekt abstimmen, sind Ärger beim Kunden und Frust bei den Handwerkern vorprogrammiert.

So ähnlich war das auch bei Thomas Grötz, als er vor einigen Jahren immer wieder die Malerarbeiten bei komplexen Baustellen auszuführen hatte. Grötz merkte, daß die perfekte Abstimmung und Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken letztlich seine eigene Leistung und damit auch seinen Gewinn beeinflußte. „Wir trafen immer wieder auf unterschiedliche Firmen, manche waren so gut organisiert wie wir und mit anderen gab es auch böse Probleme“, erinnert sich der Malermeister. Manchmal hatte ein anderer Handwerker die Baustelle einfach nicht im Griff und für Grötz verzögerten sich die Arbeiten: „Wir mußten das ausbaden, was andere verpennt hatten, denn der Maler ist ja der letzte an Wand, Boden und Decke. Und manchmal sollten wir uns dann regelrecht überschlagen.“ Grötz wollte das besser machen. Und er merkte, daß seine Handwerkskollegen das Problem auch schon erkannt hatten. Schnell setzten sich ein Maler, ein Heizungbauer und ein Elektriker bei einem Bier zusammen und überlegten, ob sie das nicht besser könnten: Gemeinsam, statt jeder für sich. Die Idee einer engeren Zusammenarbeit war geboren. Das war Ende 1995. Einige Monate später waren aus drei Betrieben insgesamt 11 geworden und man gründete eine Kooperation.
Synergien nutzen
Das Grundprinzip einer Kooperation liegt in der Erkenntnis, daß die gemeinsame Leistungsfähigkeit der Partner größer ist als die Summe ihrer Einzelleistungen. Das nennt man Synergieeffekt. Damit ein solcher eintreten kann, müssen die Kooperationspartner in Bezug auf das Kooperationsvorhaben das gleiche Ziel verfolgen. Und sie müssen kooperationsfähig sein. Kooperationsfähigkeit setzt die Bereitschaft zur Einschränkung der eigenen Entscheidungsfreiheit voraus, denn alle Entscheidungen, die die Kooperation betreffen, müssen von allen Partnern gemeinsam vorbereitet und getroffen werden. Entsprechend zeigt sich auch immer wieder, daß Kooperationen wesentlich häufiger an ihrem Management scheitern als an ihrer fachlichen Kompetenz. Wer also nicht bereit ist seine Interessen mit denen der Kooperation in Einklang zu bringen, der sollte einer Kooperation lieber fern bleiben.
Ergänzen und Vertrauen
Die Idee der Kooperation ist die Ergänzung. Man könnte auch sagen „jeder macht, was er am besten kann“. Im Idealfall ergänzen sich die Fähigkeiten der Kooperationspartner derart, daß es für jede Aufgabe einen Spezialisten gibt. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben ist die Kontrolle der einzelnen Beteiligten oft sehr aufwendig und wird daher regelmäßig nur in Ansätzen vollzogen. Genau deshalb sind Offenheit und Vertrauen zwischen den Partnern eine wichtige Erfolgsgrundlage. Probleme müssen rechtzeitig offen angesprochen und im Konsens gelöst werden. Hierfür hat es sich bewährt die wichtigsten Abstimmungsregeln in der Kooperationsvereinbarung schriftlich niederzulegen und konsequent auf ihre Einhaltung zu drängen.
Durststrecke überwinden
Im Durchschnitt dauert es zwei Jahre bis eine Kooperation das einbringt, was sich die Partner davon versprechen. In dieser Zeit müssen sich die Abstimmungsregeln bewähren, im Tagesgeschäft wie im Konfliktfall. Die Partner müssen ihre Kooperationsbeiträge aufeinander einspielen und nicht zuletzt muß sich die Kooperation am Markt einen Namen machen. Im Falle der Kooperation, der Thomas Grötz angehört, hat das alles geklappt. Grötz sagt heute: „Die Kooperation war eine der besten Sachen, die ich je gemacht habe.“
In den nächsten Teilen dieser Reihe stellt Malerblog.net erfolgreiche Kooperationsformen vor und untersucht deren Erfolgsparameter.